Zufälligerweise ist für mich als Christ auch gerade Fastenzeit. Ich kann von daher verstehen, dass es für die muslimische, vornehmlich türkisch geprägte Community hier in Köln eine besondere Zeit ist. Sie lenkt für sie wie für mich den Blick darauf, wie halte ich es mit Gott, meinen Mitmenschen und mir. Soweit alles in Butter…
Was mich am Ramadan in der Vergangenheit immer wieder befremdet hat, was das Verhalten vieler Schüler von mir, wenn der Ramadan in die Sommermonaten fiel. Sie kamen unterzuckert und häufig deutlich aggressiver als sonst in den Unterricht. Ich hatte sogar einen ehemals muslimischen Bekannten gefragt, ob es für dieses Problem ’Ramadan mit Extremtemperaturen’ kein Rechtsgutachten gibt, das hier auf breiter Front Ausnahmen zuließe. Der Bekannte erklärte sich für unzuständig, was ich mit Blick auf seine Verfolgung durch die Türkei und Nicht-mehr-Muslim-sein verstehen konnte.
 Dieses Jahr sind die Fastenregeln (kein Essen, kein Trinken während des Tages) besser zu ertragen. Was mich heuer befremdet, ist die abendliche Ramadan-Beleuchtung zum Beispiel auf der Venloer Straße. Ich hätte überhaupt kein Problem mit solch’ einer Wertschätzung religiösen Lebens, wenn sie nur minimal auf Wechselseitigkeit beruhen würde. Blicke ich jedoch auf die Türkei oder – noch schärfer ausgeprägt – auf Aserbeidschan, kann ich dort nur eine gezielte Unterdrückung der christlichen Religion feststellen. In Aserbeidschan werden im Gebiet von Berg Karabach jahrhundertealte Kirchen unwiederbringlich zerstört. Nichts und niemand soll daran erinnern, dass hier Christinnen und Christen über Jahrhunderte gewohnt haben. In der Türkei geht die aktive Verdrängung alles Christlichen etwas subtiler vor sich: Umgehungsstraßen oder andere Straßenprojekte werden vorzugsweise dort entlang geführt, wo sich noch Überreste von Kirchen und Kapellen befinden. Mit juristischen Winkelzügen wird in Istanbul verhindert, dass armenisch-stämmige Christen ein Priesterseminar, das ihnen vor dem Genozid gehört hat, wieder nutzen können.
Dieses Jahr sind die Fastenregeln (kein Essen, kein Trinken während des Tages) besser zu ertragen. Was mich heuer befremdet, ist die abendliche Ramadan-Beleuchtung zum Beispiel auf der Venloer Straße. Ich hätte überhaupt kein Problem mit solch’ einer Wertschätzung religiösen Lebens, wenn sie nur minimal auf Wechselseitigkeit beruhen würde. Blicke ich jedoch auf die Türkei oder – noch schärfer ausgeprägt – auf Aserbeidschan, kann ich dort nur eine gezielte Unterdrückung der christlichen Religion feststellen. In Aserbeidschan werden im Gebiet von Berg Karabach jahrhundertealte Kirchen unwiederbringlich zerstört. Nichts und niemand soll daran erinnern, dass hier Christinnen und Christen über Jahrhunderte gewohnt haben. In der Türkei geht die aktive Verdrängung alles Christlichen etwas subtiler vor sich: Umgehungsstraßen oder andere Straßenprojekte werden vorzugsweise dort entlang geführt, wo sich noch Überreste von Kirchen und Kapellen befinden. Mit juristischen Winkelzügen wird in Istanbul verhindert, dass armenisch-stämmige Christen ein Priesterseminar, das ihnen vor dem Genozid gehört hat, wieder nutzen können.
Von daher erlebe ich die Politik der Stadt Köln gegenüber der muslimischen Community (Gebetsruf von der Zentralmoschee, Ramadanbeleuchtung) eher wie einen großen Kotau. Ich wäre froh, wenn ich anderes sagen könnte…
Quellen:
• Zukunft gesucht von Tigran Petrosyan (taz, 4.10.2023)
https://taz.de/Massenflucht-aus-Bergkarabach/!5961130&s=berg+karabach/
• Unbequeme Spuren. Zerstörung armenischer Kultur von Lisa Schneider (taz, 29.9.2024)
https://taz.de/Zerstoerung-armenischer-Kultur/!5960840&s=berg+karabach/
• Christentum in der Türkei (Wikipedia-Artikel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum_in_der_Türkei


 Mit Henriette Reker erhält das bislang Jahr um Jahr wieder abgebaute Denkmal zur Erinnerung an den im Gebiet der heutigen Türkei verübten Genozid eine prominente Fürsprecherin. (KStA 10./11.6.23) Es wird sich erweisen, ob die Initiative „Völkermord erinnern“, die Stadt Köln und die Kräfte der Zivilgesellschaft sich gegen die Pressionen von Ditib, Grauen Wölfen und „Initiativ Türk“ durchsetzen können und diesem Denkmal einen dauerhaften Platz sichern.
Mit Henriette Reker erhält das bislang Jahr um Jahr wieder abgebaute Denkmal zur Erinnerung an den im Gebiet der heutigen Türkei verübten Genozid eine prominente Fürsprecherin. (KStA 10./11.6.23) Es wird sich erweisen, ob die Initiative „Völkermord erinnern“, die Stadt Köln und die Kräfte der Zivilgesellschaft sich gegen die Pressionen von Ditib, Grauen Wölfen und „Initiativ Türk“ durchsetzen können und diesem Denkmal einen dauerhaften Platz sichern.




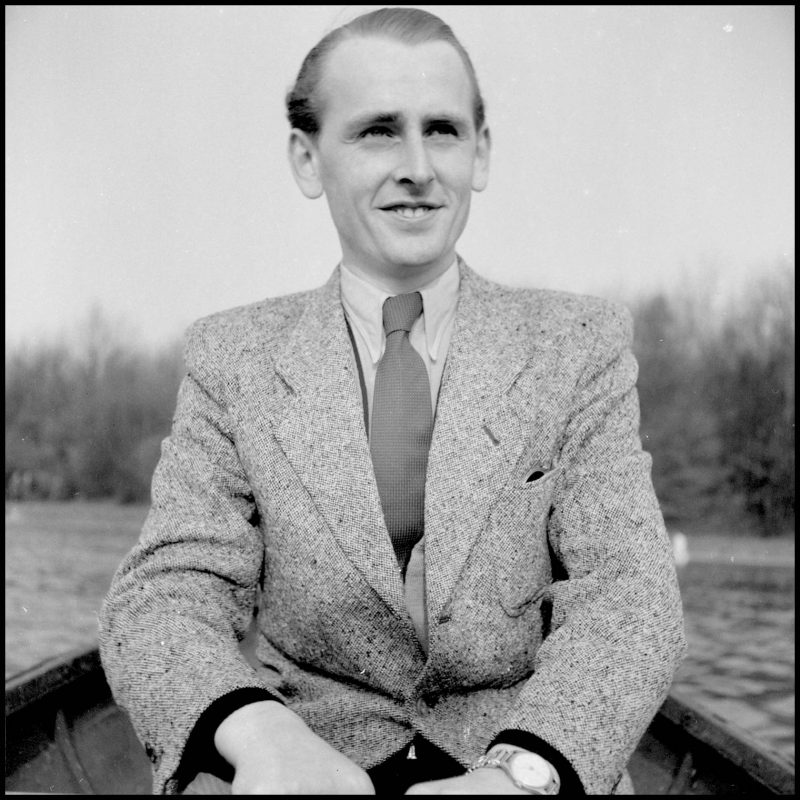
 Wieviele Saftsäcke der politischen Bühne erfreuen sich bester Gesundheit und dann stirbt so ein ruhiger und bescheidener Menschenrechtsaktivist und Schriftsteller… Nein, auch auf dieser Ebene geht es nicht gerecht zu in dieser Welt. Trotzdem sollten ihn alle Menschen in ihrem Herzen behalten. Dies gilt besonders für solche, die sich wie er für Frieden, Aufdeckung von Unrecht und beharrliches Widersprechen gegen gängige Lügen („Nein, in der Türkei hat es niemals einen Genozid an Armeniern gegeben”) einsetzen.
Wieviele Saftsäcke der politischen Bühne erfreuen sich bester Gesundheit und dann stirbt so ein ruhiger und bescheidener Menschenrechtsaktivist und Schriftsteller… Nein, auch auf dieser Ebene geht es nicht gerecht zu in dieser Welt. Trotzdem sollten ihn alle Menschen in ihrem Herzen behalten. Dies gilt besonders für solche, die sich wie er für Frieden, Aufdeckung von Unrecht und beharrliches Widersprechen gegen gängige Lügen („Nein, in der Türkei hat es niemals einen Genozid an Armeniern gegeben”) einsetzen. Ein Bauvorhaben in Köln sprengt mal wieder alle Planungsziele. Eigentlich war der Bezug des neuen, über der Mikwe und der archäologischen Zone in Rathausnähe errichteten Museums MIQUA für 2022 geplant. Um wieviel Jahre auch dieser schon nach hinten verschobene Bezugstermin gerissen wird, wissen die Götter.
Ein Bauvorhaben in Köln sprengt mal wieder alle Planungsziele. Eigentlich war der Bezug des neuen, über der Mikwe und der archäologischen Zone in Rathausnähe errichteten Museums MIQUA für 2022 geplant. Um wieviel Jahre auch dieser schon nach hinten verschobene Bezugstermin gerissen wird, wissen die Götter. Ja, es gibt nachweislich Leute, die nach einer Covid-Schutzimpfung gestorben sind. Deren Prozentzahl bewegt sich im Bereich von kleinen Bruchteilen eines Promills. Auch deren Tod gehört beklagt.
Ja, es gibt nachweislich Leute, die nach einer Covid-Schutzimpfung gestorben sind. Deren Prozentzahl bewegt sich im Bereich von kleinen Bruchteilen eines Promills. Auch deren Tod gehört beklagt.